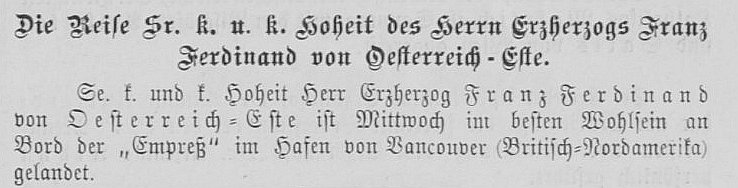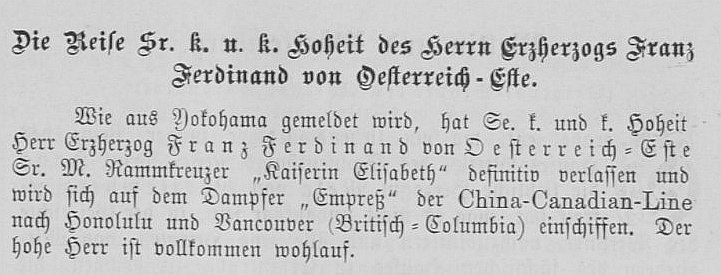Der Japaner sagt: „Nikko minai utschi-wa kekko-to iuna“ — wer Nikko nicht gesehen, rede nicht vom Schönen. Die Natur hat in der Tat alles aufgeboten, um das Gebiet von Nikko, „der Sonne Glanz“, zu dem, wie allgemein behauptet wird, landschaftlich anziehendsten Japans zu gestalten. Was jenen Namen führt, ist nicht eine städtische Ansiedlung, sondern ein etwa 600 m über dem Meer liegender, bergiger Distrikt vulkanischen Charakters; im engeren Sinn wird aber von den Japanern unter Nikko das Weichbild zweier Ortschaften im Tal des Daja-gawa, Hatschiischi und Irimatschi verstanden, wovon die erstere eine lange gerade, bis zu dem Ufer des Flusses sich erstreckende Straße bildet.
Als Mittelpunkt des Gebietes und einer Reihe aufragender Berge erhebt sich bis zu 2540 m der Nantai-san, auch Nikko-san genannt, gleich dem Fudschi einer der heiligen Berge Japans, zu dessen Gipfel die Gläubigen emporwallen. Seltener Reichtum an Gewässern belebt die Waldesruhe, klare Seen spiegeln die umrahmenden Höhen wieder, Bäche rauschen zutal, kleine Fälle bildend, deren im Umkreis von 25 km etwa dreißig gezählt werden. Was aber der Landschaft einen unvergleichlichen Schmuck verleiht, ist die üppige Vegetation, welche Berg und Tal bedeckt, sind die gewaltigen Baumriesen, monumentale Cryptomerien, die in ihrer Unversehrtheit und ihrem feierlichen Ernst dem Tal höhere Weihe geben, in dessen Erde zwei der glänzendsten Gestalten des alten Japan ruhen, der große Ijejasu und sein Enkel Ijemitsu.
Angelockt durch die herrliche Natur, verbringen viele Vertreter fremder Staaten sowie Engländer und Amerikaner im Gebiet von Nikko die heiße Jahreszeit, so dass hier die Tempelstadt auch eine Sommerfrische bildet, das Heilige und das Profane sich friedlich miteinander vertragen.
Leider war mir das Wetter nicht günstig, und von den Reizen jener Gegend, über welche ich in lebendigsten Farben gemalte Beschreibungen gelesen, die mir in Worten des Entzückens geschildert worden. bekam ich nur wenig, um nicht zu sagen, nichts zu sehen. Es goss in Strömen, die Nebel hingen tief zur Talsohle nieder, die Berge und die Wälder verschleiernd, als wollten die geheiligten Stätten sich dem Blick des Fremden entziehen, der gekommen war, nicht zu opfern und zu glauben, sondern nur zu schauen und zu genießen. Doch nicht allein die Natur, auch die Kunst hat beigetragen, Nikko zu einem Glanzpunkt Japans zu gestalten, und an deren Werken konnten wir uns des argen Wetters ungeachtet erfreuen, so dass wir früh morgens unseren Rundgang antraten.
Vorerst drangen wir in einen lieblichen Tempelgarten, um einen Oberpriester aus seiner Behausung herbeizurufen, welcher, durch so frühzeitigen Besuch sichtlich überrascht, sich endlich gefasst hatte und das Sambutsu-do, das ist die Halle der drei Buddhas, aufsperrte. Diese gleicht völlig den Bauwerken, welche wir bisher schon gesehen, und ist nur ausgezeichnet durch drei in riesigen Dimensionen gehaltene, vergoldete Bildnisse, deren eines die Göttin Kwan-on mit ihren tausend Händen, das zweite Amitabha und das dritte abermals Kwan-on mit einem Pferdehaupt darstellt.
Größeres Interesse flößt eine außerhalb der Halle befindliche Säule, Sorinto genannt, ein, die 1643 errichtet wurde und zwar zu dem Zweck, um böse Einflüsse abzuwehren; sie ist 13 m hoch, aus Kupfer in zylindrischer Form hergestellt und in ihrem unteren Teil von zwei Paar horizontalen, rechtwinkelig sich schneidenden Querbalken durchkreuzt, die mit ihren Enden auf niedrigen Kupfersäulen ruhen. Das obere Ende der Mittelsäule ist mit einer Reihe übereinander angeordneter, der Lotosblume nachgebildeter Zierate versehen, von welchen kleine Glocken niederhängen.
Unter dem Dach der mit ihren Asten sich berührenden und so einen vollständigen Schluss bildenden Cryptomerien dahinschreitend, wandten wir uns dem Tempelmausoleum Ijejasus zu. Tiefe Stille, feierliche Ruhe herrscht im Bereiche der ehrwürdigen Bäume, deren dichte Benadelung kaum einem Sonnenstrahl gestattet durchzudringen und deren kerzengerade, rotbraune, oft mehrere Meter im Umkreis messende Stämme mit dem zarten, lichtgrünen Moos kontrastieren, welches den Boden bedeckt. Während man sonst so häufig durch den Anblick einer vielgepriesenen Naturschönheit enttäuscht wird, tritt hier gerade der gegenteilige Effekt ein; ich hatte mir, aller Schilderungen ungeachtet, die Wirkung dieser bedeutende Flächen bedeckenden Riesenbäume nicht so großartig vorgestellt und war hievon geradezu überwältigt.
Schon im Jahre 767 hatte hier in Nikko der Priester Schodo Schonin den ersten buddhistischen Tempel errichtet und dadurch den Grund zur Heiligung des Ortes gelegt; aber seine eigentliche Bedeutung hat Nikko erst erlangt, seit der große Schogun Ijejasu, vom Mikado als „Hoheit des ersten Ranges, Licht des Ostens, große Inkarnation Buddhas“ unter die Zahl der Götter versetzt, im Jahre 1617 hier bestattet wurde. Die Tempelanlage besteht aus einem Komplex terrassenförmig angeordneter Gebäude und Höfe, welche durch Treppen und Tore miteinander in Verbindung stehen. Durch die Aste zweier Reihen Cryptomerien blinkt uns das über 8 m hohe, aus Granit gefügte Portal entgegen, zu dem einige breite Stufen emporführen; der Fürst von Tschikusen hat dasselbe 1618 mit dem seinen Steinbrüchen entnommenen Material erbaut. Im ersten Hof wird das Auge durch die in leuchtendem Rotlack erglänzende Pagode gefesselt, welche in fünf Stockwerken aufragt und in der Höhe des untersten Stockwerkes von Darstellungen des Tierkreises umrahmt ist.
Die in einiger Entfernung weiter emporführende Treppe ist gekrönt durch das Ni-o-mon, das Tor der zwei Könige, mit zum Teil kunstvoller Darstellung von Löwen, Tigern, Einhörnern, Tapiren und fabelhaftem Getier reich versehen, die hier teils als Wächter, teils in anderer mystischer Funktion angebracht sind. Aus dem Tor heraustretend, befinden wir uns auf der ersten, durch eine intensiv rot bemalte Holzwand umfassten Terrasse der Tempelanlage und sind förmlich gebannt durch die harmonische Gesamtwirkung, zu welcher die stilvollen Bauten, die reiche Fülle künstlerischer Details, die Pracht der Farben, die lebhafte Bewegtheit und doch vornehme Ruhe der Dekoration ineinanderfließen. In drei durch ihre gefälligen Formen ausgezeichneten Gebäuden werden hier alle für die religiösen Zeremonien zu Ehren Ijejasus erforderlichen Gegenstände, ferner solche, deren der Schogun sich bediente, und Tempelschätze aufbewahrt, während ein anderer, prächtig geschmückter Bau eine Sammlung buddhistischer Schriften birgt. Aus dem Jahre 1618 stammt eine Zisterne, welche das geheiligte, für die Waschungen bestimmte Wasser liefert und, aus einem Stück Granit gemeißelt, durch ein Dach geschützt ist, das auf zwölf Granitsäulen ruht.
Ein kleinerer Hof, dessen Front durch eine steinerne Balustrade abgeschlossen ist und den man über eine Treppe erreicht, enthält nicht weniger als 118 Bronzelaternen, jede einzelne ein Kunstwerk, Weihegeschenke von Daimios und anderen vornehmen Spendern, deren
Namen auf den Laternen verewigt sind. Eine weitere Anzahl von Bronzelaternen und Kandelabern — einige hievon sollen aus Korea, andere aus den Niederlanden stammen — fallen durch ihre Größe sowie durch ihre reiche, künstlerische Gestaltung auf.
Durch das zweite große Tempelportal, das Jo-mei-mon, gelangten wir in den dritten Tempelhof. Dieses Portal verdient ein Juwel der japanischen Bau- und Dekorationskunst genannt zu werden; hier haben sich Meister ihres Faches die Hand gereicht, um das Gewaltige mit dem Zarten zu paaren, um dem Können ihrer Zeit ein dauerndes, unser Staunen und unsere Bewunderung erweckendes Denkmal zu setzen. Ein reich geschmücktes, geschweiftes und auf vergoldeten Drachenköpfen ruhendes Dach schützt das Tor, welches von mächtigen Säulen getragen wird, die mit einem klein gehaltenen, geometrischen Dessin bedeckt und weiß bemalt sind. Die Kapitäler der Säulen zeigen Köpfe des Einhorns, während die Tragbalken entlang rings um das Tor Drachenköpfe laufen und im Mittelfeld der Kampf zweier Drachen dargestellt ist.
Ein Gebäude des Hofes enthält die Bühne für die Kagura-Tänze, ein anderes das Goma-do, einen Altar zur Verbrennung von Räucherwerk, während ein drittes die Tragsessel birgt, welche am 1. Juni jedes Jahres angeblich von drei Gottgeistern, Ijejasu und zwei anderen zu Gottheiten erhobenen großen Männern, eingenommen und dann in einer feierlichen Prozession herumgetragen werden. Auf der Tanzbühne machte eine der Tänzerinnen rastlos tiefe Verbeugungen vor uns, wahrscheinlich gerne bereit, mit ihren Genossinnen eine Probe ihrer Kunst zum besten zu geben, die wir doch schon in Nara kennen gelernt hatten. Die Ränder und die Wände der Terrasse werden von kunstvoll gearbeiteten Steinreliefs bedeckt, welche allerlei Vögel und Pflanzen wiedergeben.
Durch das Chinesische Tor oder Kara-mon nähern wir uns dem Haupttempel, dessen Flügeltüren mit Arabesken in vergoldetem Relief verziert sind. Von mehreren Priestern geleitet, betraten wir, nachdem wir über unsere Schuhe noch Wollpantoffel angelegt hatten, das Innere des Tempels, welcher beiderseits Vorräume besitzt, die durch meisterhaft ausgeführte Holzschnitzereien und durch Malereien auf Goldgrund sowie durch reiche Ornamentik ausgezeichnet sind. Das Bethaus des Tempels ist sehr einfach gehalten und birgt im Hintergrunde das Gohei sowie den Spiegel; denn auch in dem Tempelmausoleum Ijejasus wurde nach dem Jahre 1868 durch Einschreiten der Regierung der buddhistische Kultus zugunsten des schintoistischen verdrängt, so dass aus dem Bethaus alle dem ersteren dienenden Symbole und Gerätschaften entfernt wurden.
Das Allerheiligste, zu dem der Weg durch das Bethaus führt, ist mittels vergoldeter Pforten abgeschlossen. Angesichts dieser offenbarte sich der Vorzug, dessen ein Reisender sich erfreut, der nicht als einfacher Tourist durch die Lande zieht, mag immerhin letzterer wieder manche Unannehmlichkeit, welche das Reisen in offizieller Eigenschaft mit sich bringt, nicht zu bestehen haben. Das Allerheiligste zu schauen, ist strenge verpönt, keines Fremden Fuß soll bisher diese heiligsten der Räume betreten haben; vor mir aber taten sich die Pforten auf. Ich gestehe, dass mir dies zur besonderen Befriedigung gereichte, dass sich meiner ein Gefühl des Reisestolzes bemächtigte bei dem Gedanken, eines Anblickes teilhaftig zu werden, der bisher in der Tat noch keinem Europäer gegönnt war, vielleicht auch nicht gegönnt sein wird, und ich werde es zeitlebens dem wackeren Freunde Sannomija zu Dank wissen, dass er mir die hier geborgenen Wunderwerke menschlicher Kunst und Phantasie zu erschließen verstanden hat.
Das Sanctuarium zerfällt in mehrere Räume, deren einer einen Altar mit dem goldenen Gohei und dem Metallspiegel enthält; die hier befindlichen kunstvollen bildlichen Darstellungen buddhistischer Auffassung sind mit Tüchern verhängt. Begreifliches historisches Interesse erweckt die daselbst verwahrte Rüstung des tapferen Schoguns, welche, sehr einfach ausgestattet und mit schwarzem Lack überzogen, den nunmehr zum Gott erhobenen Mann geschützt hat, da er im Schlachtengetümmel den Grund zur Macht seines Hauses legte. Bei schwachem Kerzenschein besahen wir das prunklose Eisenkleid, bis die Priester mittels einiger Laternen den in geheimnisvolles Dunkel getauchten Raum erhellten und unsere Blicke auf einen reich vergoldeten Schrein fielen. Vor diesem warfen sich die Priester nieder, berührten mit der Stirn den Boden und öffneten schließlich eine Art Tabernakel, in dem sich hinter einem Vorhang als letzter Hülle das Sanctissimum befand — eine bemalte Figur, Ijejasu in sitzender Stellung wiedergebend. Dieses Gottesbild vermag wohl in niemandem religiöse Ergriffenheit zu wecken; dafür aber versetzten mich der Schrein, welcher den Götzen birgt, die Dekoration der Wände und die an den Türen ersichtliche Arbeit in helles Entzücken. Mit Bedauern erfüllte mich nur, dass durch die Umstände, namentlich durch Mangel an der erforderlichen Beleuchtung, eine eingehende Besichtigung der Kleinode japanischer Kunst, welche sich uns darboten, erschwert war, so dass ich mich mit dem Gesamteindruck begnügen musste. Hier war in der Tat Verschwendung getrieben worden mit der Ausschmückung des Schreines, der Wände und der Türen durch Bemalung, Vergoldung und Schnitzerei; der entfaltete künstlerische Reichtum an Motiven und deren vollendete Wiedergabe scheint im ersten Momente fast sinnverwirrend, ordnet sich aber bei näherer Betrachtung zu völliger Harmonie, zu wohltuender Ruhe. Ijejasu, der als Mensch Großes, Gewaltiges geleistet, indem er der Geschichte seines Landes eine fast dreihundertjährige Bahn vorzeichnete, hat hier als Götze Wunder gewirkt, da er durch sein Andenken zu so hoher Kunstleistung, wie sie uns hier entgegentritt, zu begeistern vermocht hat.
Von der Stätte, welche des Gottes Bild umschließt, schreiten wir jener, welche des Toten Asche birgt, zu, klimmen über 240 Stufen aus Stein, die von Moos bedeckt sind, empor und stehen vor dem Grab Ijejasus. Ein hoher Steinsockel trägt eine Urne aus Bronze, welche die Überreste des Schoguns enthält; vor dem Sockel sind auf einem Steinaltar als Symbole aufgestellt ein Räuchergefäß, eine Vase mit Lotosblüten und anderen Blumen sowie ein großer Kranich, der auf dem Rücken einer Schildkröte steht und ein als Leuchter dienendes Blatt im Schnabel hält — alles wertvolle Bronzearbeit. Eine Steinbalustrade umfriedet das Grabmal; der Eingang führt durch ein massives Tor aus Bronze, das von zwei Löwen bewacht wird. Ernst ist der Platz, den sich Ijejasu selbst als Ruhestätte auserkoren, und die erhabene Einfachheit des Grabmales ergreifend; die Kunst, die sich in den zu Füßen des Grabes liegenden Bauwerken ein hohes Lied gesungen, scheint hier verstummt, als sollte derjenige, welcher emporgepilgert ist, in seinen dem Toten zugewandten Gedanken nicht durch bildnerischen Schmuck abgelenkt werden.
Nochmals kehrten wir zum Haupttempel zurück, um den stimmungsvollen Effekt zu genießen, welchen der Einklang des architektonischen Aufbaues der Tempelanlage mit deren landschaftlicher Umrahmung und mit dem majestätischen Walde hervorbringt — und der Zauber dieser Wirkung wird noch erhöht durch den tiefen, über dem Grabmal des gewaltigen Kriegers ausgebreiteten Frieden, zu welchem heute der Regen eine melancholische Weise rieselte.
Der Tempelschatz, dem wir ebenfalls unseren Besuch abstatteten, enthält wie andere Räume gleicher Art kostbare Weihgeschenke hervorragender Personen, so Waffen, Rüstungen, Sattelzeug, allerlei Gerätschaften für feierliche Umzüge, Gebetrollen, ferner 50 m und mehr messende Rollen mit Darstellungen aus der Geschichte des Landes oder der Götterlehre. Besondere Erwähnung verdienen alte Kakemonos, welche Falken in täuschender Naturtreue und Szenen, die der in Japan angeblich noch immer betriebenen Falkenjagd entnommen sind, wiedergeben. In früheren Zeiten soll es möglich gewesen sein, von den habgierigen Bonzen durch Geld und gute Worte — und zwar durch mehr von dem ersteren als von den letzteren — einzelne der im Tempelschatz verwahrten Objekte zu erwerben. Als jedoch dieser Unfug infolge der großen Dimensionen, die er angenommen, Aufsehen erregt hatte, wurde demselben durch genaue Inventierung der Tempelschätze gesteuert.
Nach dem Tempelgrab Ijejasus konnten uns zwei andere Tempelanlagen, welche wir mehr durcheilten, als genau besahen, nicht mehr dasselbe Interesse einflößen.
Der uns begrüßende, in prachtvolle, violette Gewandung gehüllte Oberpriester des einen dieser Tempel war früher ein mächtiger Daimio der Nordprovinzen und hatte sich in dem Kampfe zwischen dem Mikado und dem Schogun auf die Seite des letzteren gestellt; besiegt und seines Landes verlustig, wurde dem Daimio Gnade zuteil und nebst dem ihm zuerkannten Grafentitel als eine Art Pension die Stelle des Oberpriesters an diesem Tempel verliehen.
Die zweite Tempelanlage, das Mausoleum Ijemitsus, teils einem tief eingeschnittenen Tal entlang, teils auf der Lehne eines Berges erbaut, liegt unweit der Grabstätte Ijejasus und ist weit weniger glänzend ausgestattet, immerhin aber beachtenswert, weil sich hier der Buddhaismus behauptet hat und daher der ganze Ausstattungsapparat, dessen jener sinnfällige Kultus bedarf, noch vorhanden ist. Die bei den Tempeltoren postierten Tempelwächter repräsentieren eine stattliche Versammlung der scheußlichsten Fratzen; wir sehen hier einen roten und einen grünen Teufel, die zwei kühnen, goldenen Könige und zwei Figuren in Menschengestalt, welche mit dem ganzen Aufgebote der üppigen buddhistischen Phantasie greulich ausgestattet sind; die eine, rot gefärbte stellt die Gottheit des Donners dar. welche vergoldete Schlägel in der Hand hält und einen über den Rücken geschwungenen Reif mit neun flachen Trommeln trägt, aus denen Blitze sprühen; das andere Scheusal, in hellblaue Farbe getaucht, repräsentiert den Gott des Windes und blickt uns mit aus Krystall gefertigten Augen sowie mit satanischer Miene an, indem es auf einem Steinblock sitzt und einen über den Rücken geworfenen Windsack mit den Händen zuhält. Votivlampen aus Bronze deuten auf die Verehrung hin, deren sich Ijemitsu erfreut.
Von hier fuhr ich direkt nach Nikko oder richtiger nach Hatschiischi und passierte abermals den schäumenden Daja-gawa, dessen beide Ufer durch zwei Brücken verbunden sind; die eine dient dem allgemeinen Verkehr, während die andere, Mihaschi, dem Mikado vorbehalten ist und nur zweimal des Jahres für Pilgerzüge geöffnet wird. An der Stelle, wo der Buddha-Priester Schodo Schonin vor mehr als tausend Jahren eine wunderbare Erscheinung gehabt haben soll, erbaut, ruht die Brücke, in hellrotem Lack leuchtend, auf steinernen Pfeilern, welche in die Felsen eingelassen sind.
Im Städtchen wandte ich mich dem Einkauf von Pelzwaren zu, deren es hier eine große Auswahl gibt und die insofern kulturhistorische Anklänge wachrufen, als vor den Umwälzungen des Jahres 1868 neben anderen auch alle jene, die sich mit Lederbearbeitung, mit Rauhwaren u. dgl. m. befassten, im Gegensatz zu den Heimin oder Angehörigen des gewöhnlichen Volkes, den Etas oder Unreinen, zugezählt wurden, das heißt einer verachteten, von der sonstigen Gesellschaft ausgeschlossenen Kaste, die in besondere Ortschaften oder Stadtteile verwiesen war — eine Stellung, die vermutlich auf buddhistischen Einfluss zurückzuführen ist. Noch tiefer standen nur die Hinin, die Nichtmenschen, eine erst unter den Tokugawas entstandene Klasse Armer, welchen nur gestattet war, sich auf unkultiviertem Lande niederzulassen.
Unter den vorrätigen Rauhwaren fand ich auch solche, die bei uns unbekannt sein dürften, so Felle der japanischen Antilope, von Affen, von Bären der Insel Jeso, von Dachsen zweierlei Arten, von Ottern, deren Art von der bei uns vorkommenden verschieden zu sein scheint, von Seehunden und von großen Eichhörnchen; auch zwischen chrom- und ockergelb variierende Felle von Mardern sowie originelle, aus Fellen gefertigte Hausschuhe waren erhältlich. Bald wanderte ein Rickscha schwer beladen mit den erstandenen Waren in unser Hotel. Da die Wege in der Umgebung Nikkos, wie man mir sagte, mit Rücksicht auf meinen bevorstehenden Besuch mit großen Kosten in guten Stand gesetzt worden waren, wollte ich dies Opfer nicht nutzlos gebracht wissen und entschloss mich trotz des strömenden Regens, eine Fahrt nach dem Urami-go-taki genannten Wasserfall zu unternehmen. Von der vielgerühmten landschaftlichen Schönheit der durchfahrenen Strecke bekamen wir des Regens halber leider nichts zu Gesicht und mussten, unter unseren Regenschirmen hervorlugend, mit dem Anblick der in nächster Nähe gelegenen, in frischem Grün prangenden Wiesen und Wälder vorlieb nehmen, welch letztere hier mannigfache Baumarten aufweisen, so auch Eichen und Ahorne. Kleine Weiler und Ortschaften, trübselig genug im Regen dreinsehend, lagen am Weg.
Unsere Rickschaläufer hatten ein schweres Stück Arbeit in der schlüpfrigen, grundlosen Fahrbahn zurückgelegt, als sie bei einem Teehaus hielten, von wo wir den Marsch zu Fuß eine romantische Schlucht aufwärts antraten. Bald hören wir das Rauschen des Wasserfalles und sind endlich in einem von hochaufragenden Felsen eingeschlossenen Talkessel; hier stiebt ein Gebirgsbach aus einer Höhe von 15 m eine prächtige Kaskade bildend, über eine Felswand herab in ein trichterförmiges Becken. Infolge des starken Gefälles oberhalb der Felswand und deren senkrechter Stellung stürzt die Wassermasse in einem weiten Bogen ab, so dass es möglich ist, unterhalb des Falles und hinter demselben vorbeizuschreiten, ohne größere Gefahr zu laufen, als von einem feinen Sprühregen benetzt zu werden. Der Urami-go-taki gehört nicht zu den Wundern seiner Art, bietet aber immerhin im Rahmen der engen Schlucht ein sehenswertes Schauspiel, namentlich weil die Erde hier aus zahllosen Falten, Schlitzen und Löchern Wässerchen zutage sendet, die eilfertig sprudelnd über die Felsen der Talsohle zurieseln.
Hinter dem Wasserfall steht eine Buddha-Statue, bei welcher die eingeborenen Ausflügler Visitkarten abzugeben pflegen, um der Nachwelt Kunde von dem staunenerregenden Ereignis ihrer Anwesenheit zu geben. Die Ortseitelkeit scheint also nicht nur bei uns, sondern auch im fernen Osten eine Heimat zu haben, allerdings in einer Form, die geschmackvoller ist als die bei uns übliche, verunstaltende Beklecksung von Mauern und Felsen, und es wäre daher unseren Reisenden und Touristen die Adoptierung des japanischen Gebrauches dringend anzuraten.
Während der Rückfahrt machte ich halt vor einer kleinen, am Ufer des rauschenden Daja-gawa reizend gelegenen Villa, welche Sannomija gehört und ihn zur Sommerszeit beherbergt; ich sprach hier bei dessen Gattin vor, die längere Zeit in Wien verbracht hat und das Deutsche vollkommen beherrscht.
Bei einer Avenue von 100 steinernen Buddhas vorbeifahrend, kehrten wir nach Nikko zurück, um noch einige Einkäufe zu besorgen und sodann eine Strecke in der herrlichen Cryptomerien-Allee dahinzurollen, die ich gestern während der Fahrt nach Nikko nur im Dunkel der Nacht gesehen. Unter diesen Bäumen wandelnd, fühlt man sich von dem Hauch einer stolzen Vergangenheit umweht. Bemerkenswert, sind namentlich zahlreiche Zwillingsbäume, die etwa bis auf den dritten Teil ihrer Höhe miteinander verwachsen sind.
Eine vielgepriesene Landschaft, welche die bösartige Anwandlung hat, sich gelegentlich einmal nur im Regenkleide zu zeigen, gleicht einem des besten Rufes sich erfreuenden Menschen, der auf einem Fehler ertappt, Gefahr läuft, von den bösen Zungen in Bausch und Bogen verdammt zu werden. Ich will gegen Nikko gerechter sein; es hat sich wie eine Schöne benommen, die, ihrer Reize und deren Wirkung sicher, Gefallen daran findet, ein schmollendes Gesicht zu zeigen — und mir gegenüber hat Nikko ununterbrochen geschmollt. Gleichwohl war ich, des unvollkommenen Eindruckes, den ich empfangen, ungeachtet, entzückt und kann auf den ganzen Zauber schließen, welchen der heilige Boden Nikkos, von dem Glanz eines schönen Sommertages überhaucht, auszuüben vermag.
Abends taten wir, was unter den Umständen das Geratenste war; wir ließen uns die Laune nicht verderben und vereinigten uns zu einem heiter verlaufenden Diner, welches durch die drolligen Geschichten gewürzt wurde, die Schiffskapitän Kurvaka von der japanischen Suite, immer mehr auftauend, in komischem Durcheinander französischer, englischer und japanischer Worte zum besten gab. Schließlich gestattete Jupiter pluvius, gerade als uns der schwarze Kaffee durch neckische Musumes serviert wurde, sogar die Abbrennung eines Feuerwerkes.
Links
- Ort: Nikko, Japan
- ANNO – am 21.08.1893 in Östereichs Presse.
- Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater ein Ballet „Cavalleria Rusticana“ aufführt.